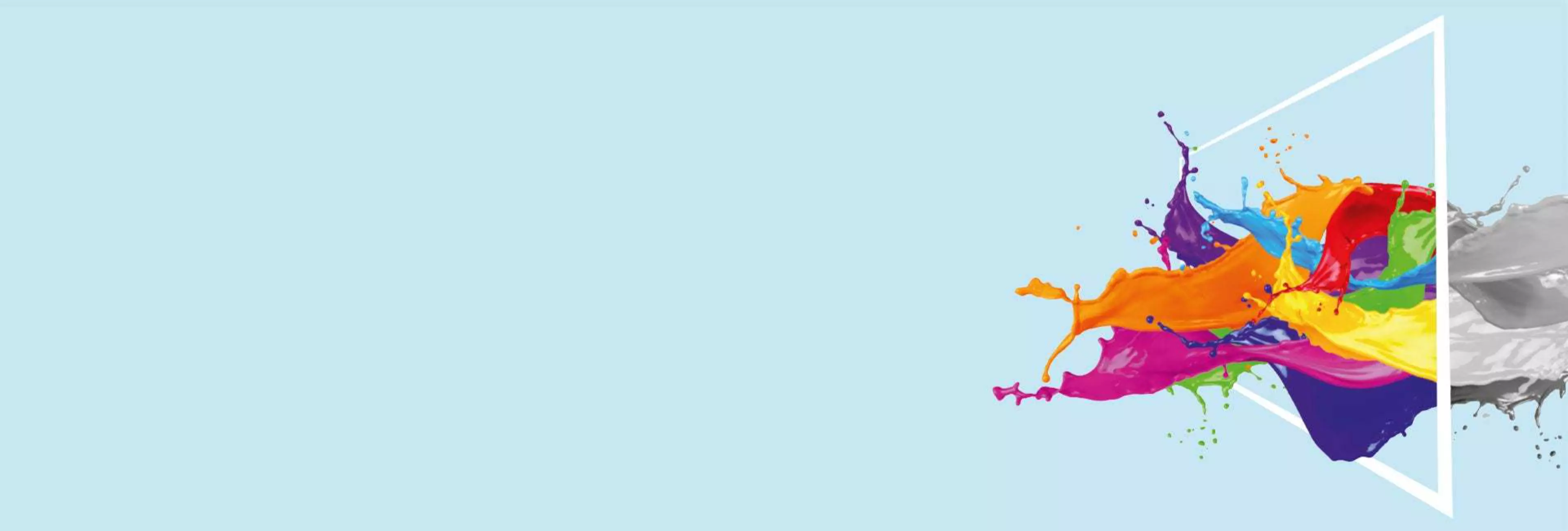Wissensdurst zum Thema Kreislaufwirtschaft? Lehnen Sie sich zurück, nehmen Sie einen Schluck von Ihrem Heißgetränk – und schon sind wir mittendrin in der Materie. Denn wenn Sie gerade aus einem To-Go-Becher trinken, haben Sie möglicherweise ein häufiges Missverständnis in der Hand und die einfache Lösung vor Augen.
To-Go-Becher stehen wie kaum ein anderer Gegenstand für die Wegwerf-Gesellschaft: Sie werden in der Regel keine 15 Minuten lang genutzt und landen danach (bestenfalls) im Müll. 8 Millionen städtische Standard-Mülleimer kommen jedes Jahr allein in Deutschland zusammen. Unzählige Becher enden dagegen im Gebüsch. Umweltschädliche Einwegbecher – sind die nicht in der EU verboten? Jein. Seit 2021 sind Einweg-Plastik-Produkte wie Trinkhalme, Wattestäbchen und Becher zwar tabu. Und tatsächlich: Auf vielen Papp-Bechern ist ein Recycling-Symbol zu sehen. Doch die Pappe ist meistens von einer Kunststoffschicht überzogen, die sich kaum davon trennen lässt. Also werden die Becher verbrannt oder landen auf der Deponie.
Bye-bye, Wegwerf-Wirtschaft
Rohstoffe ausgraben, Produkte herstellen, kurz nutzen, einfach wegwerfen – mit diesem klassischen Wirtschaftsmodell sind viele von uns groß geworden. Das Problem dabei: Unser Ressourcenverbrauch liegt heute weit über dem, was unser Planet hergibt. 2017 lag der sogenannte weltweite Material-Fußabdruck bei 92 Milliarden Tonnen. Maximal 50 Milliarden Tonnen könnte die Erde eigentlich verkraften. Dass die Wegwerf-Wirtschaft weder umweltfreundlich noch nachhaltig ist, versteht sich also von selbst. Auch ein anderer Zusammenhang leuchtet sofort ein: Durch verschwenderischen Umgang mit natürlichen Ressourcen werden diese immer knapper. Und sehr knapp bedeutet sehr teuer. Deshalb haben nach den Umwelt-Aktivist*innen und der Politik auch viele Unternehmen begonnen, neue Wege zu gehen.
Kreislaufwirtschaft: Alles Müll – oder was?
Wer „Kreislaufwirtschaft“ hört, denkt zunächst an Mülltrennung – zurecht. Schließlich hat das Gewinnen von wertvollen Ressourcen aus Abfall mittlerweile Tradition. Doch die Idee hinter der Kreislaufwirtschaft geht weiter: Sie soll zu einem geschlossenen System führen, in dem sämtliche Ressourcen zirkulieren und kaum noch neue Rohstoffe benötigt werden. Dafür ist ein Zusammenspiel aus vielen Ideen und Maßnahmen nötig. Die grundsätzlichen Prinzipien dabei:
Intelligente Nutzung
Refuse – Bestimmte Produkte überflüssig machen und nicht mehr verwenden
Reduce – Den Einsatz von Rohstoffen und Energie verringern
Rethink – Geschäftsmodelle und Produkt-Designs neu denken
Verlängerte Lebensdauer
Reuse – Produkte oder Komponenten mehrfach verwenden
Repair – Durch Reparieren die Lebensdauer von Produkten verlängern
Refresh – Gebrauchte Produkte durchlaufen einen Wiederaufbereitungsprozess
Refurbish – Ausgediente Produkte für einen neuen Einsatz generalüberholen
Remanufacture – Komponenten alter Produkte zu etwas Neuem zusammensetzen
Repurpose – Teile aus alten Produkten für einen anderen Zweck nutzen
Konsequente Wiederverwertung
Recycle – Wertvolle Materialien aus Abfall wiederverwerten
Recover – Ist keine Verwertung möglich, Energie und Grundstoffe zurückgewinnen
Beim To-Go-Becher sind „Reuse“, „Refurbish“ oder „Recycle“ schwierig. Ist „Recover“ durch Verbrennen also die einzige Option? Keineswegs – mehr dazu gleich.
Das sind Ziele der Circular Economy
Die Kreislaufwirtschaft (englisch „Circular Economy“) ist mehr als nur ein frommer Vorsatz. Eine
DIHK-Studie mit 2.000 teilnehmenden Unternehmen in Deutschland zeigt: Mehr als die Hälfte der Firmen sieht die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft als Chance und integriert sie bereits in ihr Geschäftsmodell. Die Betriebe erhoffen sich neben Kosteneinsparungen und Imagegewinn auch mehr Resilienz. Denn wackelige Lieferketten und ethisch problematische Rohstoffe machen die Nutzung von bereits im Kreislauf vorhandenen Ressourcen interessant. Auch in Österreich geht es rund: 60 % der Unternehmen wollen in den nächsten drei Jahren in die Kreislaufwirtschaft investieren. Laut einer
PwC-Studie könnte die Kreislaufwirtschaft im Land bis 2030 jährlich über 5 Milliarden Euro erwirtschaften und für eine Gesamtbruttowertschöpfung in Höhe von 35 Milliarden Euro sorgen.
Kreislauf-Wirrwarr? Gesetze, Vorgaben und Regularien
Bei allen wirtschaftlichen Chancen und freiwilligem Engagement: Die Gesetze und Regularien in Europa sind ein Hauptgrund dafür, dass Unternehmen die Kreislaufwirtschaft ankurbeln. Der „EU Green Deal“ von 2019 sieht ein klimaneutrales Europa bis 2050 vor. Ein wichtiges Instrument dabei ist der „Circular Economy Action Plan“ von 2020, also der Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft. Er enthält unter anderem verpflichtende Ökodesign-Richtlinien für langlebige Produkte, ein Recht auf Reparatur, transparente Lieferketten und Rücknahme-Pflichten für Unternehmen sowie Strategien für besondere Sektoren. Dazu kommen nationale Gesetze – in Deutschland zum Beispiel das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das Verpackungsgesetz und das
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.
Beispiel Österreich: Die nationale Kreislaufwirtschafts-Strategie
In Österreich gilt seit 2022 die
nationale Kreislaufwirtschafts-Strategie. Sie bildet den Rahmen für die Umgestaltung der Wirtschaft in eine klimaneutrale, nachhaltige Kreislaufwirtschaft bis 2050. Zentrale Ziele sind die Reduktion des Ressourcenverbrauchs sowie die Senkung des inländischen Materialverbrauchs auf maximal 14 Tonnen pro Kopf und Jahr bis 2030 (2022: 17 Tonnen). Der Material-Fußabdruck pro Person soll 2050 nur noch 7 Tonnen betragen (2020: 61 Tonnen). Dafür soll die Ressourcenproduktivität bis 2030 um 50 Prozent gesteigert, die Zirkularitätsrate auf 18 Prozent hochgefahren und der Konsum privater Haushalte um 10 Prozent gesenkt werden.
In diesen Handlungsfeldern geht’s rund
Um diese abstrakten Zahlen mit Leben zu füllen, sind Ideen nötig – und zwar in vielen Bereichen der Wirtschaft und des Alltags. Wie auch andere nationale Leitlinien nennt die österreichische Kreislaufwirtschafts-Strategie sieben „Transformationsschwerpunkte“, in denen sich einiges tun soll.
Bauwirtschaft – z. B. Gebäude modular planen und länger nutzen, Recycling-Baustoffe
Mobilität – z. B. nachhaltige Batterieproduktion und -nutzung, öffentlicher Verkehr
Kunststoffe und Verpackungen – z. B. Verpackung vermeiden, zirkuläres Produktdesign
Wohin denn nun mit dem Pappbecher?
Die Zukunft liegt in der Kreislaufwirtschaft – aber was ist mit den ganz gegenwärtigen Problemen, etwa dem Wegwerf-Becher? Die Lösung ist schon längst da, es kommt das Prinzip „Rethink“ zum Tragen: Längst sind Mehrweg-Pfand-Systeme verbreitet, bei denen der Hartplastik-Becher bis zu 1000-mal zum Einsatz kommt. Durch das Wiederverwenden („Reuse“) werden Einweg-Becher überflüssig („Refuse“). Eine genial einfache Idee, die noch nicht einmal neu ist – das zeigt ein Blick aufs Foto von Uroma mit der Milchkanne. Die Kreislaufwirtschaft ist eben dann am erfolgreichsten, wenn möglichst viele einfach mitmachen.